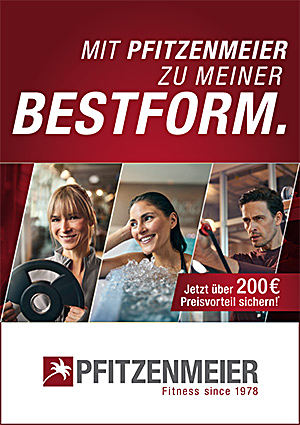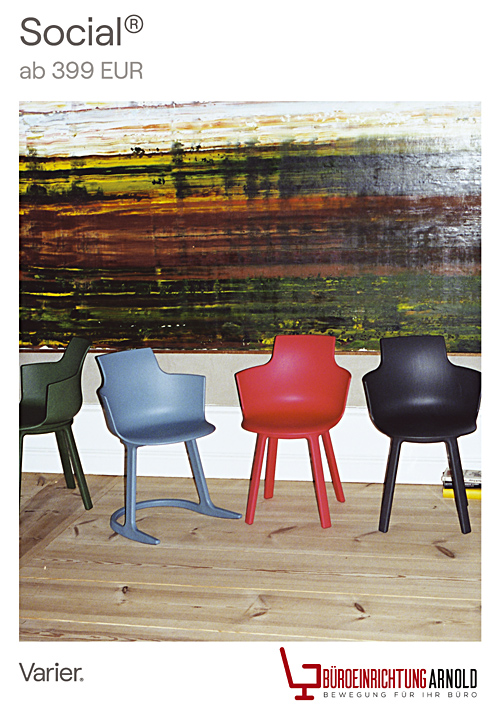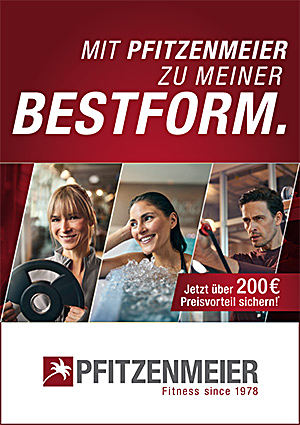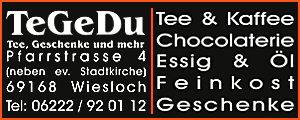Experten, die ihr Wissen unterhaltsam vermitteln: Marcus Imbsweiler (li.) und Timo Jouko Herrmann beim Talk zum Auftakt der Musiktage.
Mu
Im Mittelpunkt der 16. Walldorfer Musiktage, die bis 11. Oktober unter dem Motto „Salieri – Dichtung und Wahrheit“ stattfinden, steht der italienisch-österreichische Komponist Antonio Salieri, an dessen 275. Geburtstag und 200. Todestag in diesem Jahr gedacht wird. Lange Zeit wurde dieser bedeutende und erfolgreiche Tonkünstler und Pädagoge nicht angemessen gewürdigt und fast vergessen. Im 19. Jahrhundert wurde er sogar zum erbitterten Rivalen Mozarts stilisiert und sein bis dahin hervorragender Ruf nachhaltig geschädigt. Mit Dr. Timo Jouko Herrmann, dem Initiator und künstlerischen Leiter der Musiktage sowie Musikbeauftragten der Stadt Walldorf, hat das beliebte Festival aber einen hervorragenden und kompetenten Salieri-Kenner zur Hand.
Wie im letzten Jahr startete das Festival mit dem unterhaltsamen und interessanten „Musiktage Talk“ mit dem Schriftsteller und Musikwissenschaftler Marcus Imbsweiler und Herrmann im JUMP-Café. Während draußen leichter Regen fiel, saßen die zahlreichen Zuhörer in heimeliger Atmosphäre bei Kaffee, Tee und Gebäck an kleinen Tischen und lauschten dem lockeren Gespräch der beiden Experten, das interessante Einblicke in das Leben und Wirken Salieris bot. Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann begrüßte die beiden „Hauptdarsteller“ und das Publikum und wies darauf hin, dass Herrmann schon zum zweiten Mal sein Lieblingsthema „Salieri“ für die Musiktage ausgewählt hat. In den letzten 15 Jahren habe sich dank Herrmanns Initiative einiges in der Salieri-Forschung getan. Herrmann sei es zu verdanken, dass die völlig verzerrte Wahrnehmung des Komponisten zurechtgerückt und mit vielen historischen „Fake News“ aufgeräumt werden konnte.
Herrmann und Imbsweiler sind ein eingespieltes Team. Sie haben seit 2020 eine gemeinsame Veranstaltungsreihe im Deutsch-Amerikanischen-Institut in Heidelberg. Es war eine Freude, den beiden Experten zuzuhören. Das Gespräch verlief natürlich und ungezwungen und auch die Zuhörer wurden mit einbezogen. So fragte Imbsweiler das Publikum, was es über Salieri wisse. Das war erwartungsgemäß nicht viel. Den meisten ist der Erfolgsfilm „Amadeus“ von Miloš Forman im Gedächtnis geblieben, in dem Salieri, alt und verbittert, als bösartiger Gegenspieler des jungen Mozart dargestellt wird. Dieses Gerücht entstand schon in der Zeit der Hochromantik, erklärte Herrmann. Ein jugendliches Genie brauchte einen bösen alten Gegenspieler. Solche Stoffe wurden damals sehr geschätzt. Wie falsch dieses Narrativ ist, zeigt sich allein schon darin, dass Salieri lediglich sechs Jahre älter war als Mozart. Die neuere Salieri-Forschung hat dieses Bild nun geradegerückt. Heute ist die Quellenlage eine andere und die Musikwissenschaft erkennt endlich Salieris Bedeutung an.
Salieri war zu seinen Lebzeiten ein hochgeachteter und erfolgreicher Komponist, Kapellmeister und Musikpädagoge. In Italien geboren und früh verwaist, kam er 1766 mit nur 16 Jahren zusammen mit seinem Förderer Florian Leopold Gassmann an den kaiserlichen Hof nach Wien, wo er für den Rest seines Lebens blieb. 1774 wurde er kaiserlicher Kammerkomponist und Kapellmeister der italienischen Oper. Seine Opern waren äußerst erfolgreich, wurden in ganz Europa gefeiert und hielten sich bis ins 19. Jahrhundert auf den Spielplänen der großen Opernhäuser. Salieri war auch ein hervorragender und geschätzter Musikpädagoge, der eine ganze Generation junger Komponisten, darunter Beethoven, Schubert, Meyerbeer, Hummel, Czerny, Moscheles, Liszt und auch Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang ausbildete und prägte. Insgesamt hatte er an die 100 Schüler. Hauptaufgaben waren seine Tätigkeit am Hofe und seine Opern-Kompositionen, aber er war auch für alle musikalischen Auftritte in den Gottesdiensten am Hofe verantwortlich. Dieses ungeheure Arbeitspensum bewältigte er bis ins Alter.
Dass er nach seinem Tod so schnell in Vergessenheit geraten ist, liege auch am Aufkommen des Nationalismus, erklärte Herrmann. Die Italiener hätten ihn als Österreicher gesehen, für die Franzosen sei er Deutscher gewesen und die Österreicher meinten, er sei Italiener. Salieri war keiner Nation zuzuordnen und somit gewissermaßen „heimatlos“. Dazu kamen dann noch die Gerüchte vom bösartigen Gegenspieler Mozarts, die bis heute nachwirken.
Salieris innovatives Wirken vermittelten Imbsweiler und Herrmann anhand einiger musikalischer Aufnahmen. Den Auftakt machte aber die Klaviervariation des 17-jährigen Mozart über „Mio caro adone“, KV 180, ein Thema Salieris. Auch dies spricht gegen eine Gegnerschaft der beiden Tonkünstler. Als zweites Musikbeispiel erklang eine Orchester-Variation Salieris von 1815 über den spanischen Tanz „La folia“, ein bekanntes Thema aus der Barockzeit. Zur damaligen Zeit war es recht ungewöhnlich eine Variation über alte Musik zu schreiben. Jedes Instrument kommt hier zur Geltung und kann seine technischen Möglichkeiten und Klangfarben unter Beweis stellen. Auch eine Harfe, die eigentlich erst in der Romantik zur Blüte kommt, hat eindrückliche Soli und sogar eine Donnermaschine kommt zum Einsatz. Dieses ungewöhnliche Werk stellt den ersten Orchester-Variationszyklus überhaupt in der Musikgeschichte dar. Herrmann vermutet, dass die Variationen wohl als Anschauungsmaterial für Salieris Schüler gedacht waren.
Das nächste Musikbeispiel stammte aus Salieris erster großer Oper „Armida“ (1771). Die Geschichte um den Kreuzritter Rinaldo und die mächtige Zauberin Armida, die auf einer Insel umgeben von Nebeln wohnt, geht auf Torquato Tassos Versepos „Das befreite Jerusalem“ zurück. Die Ankunft Rinaldos auf der Nebel-Insel, der anschließende Überfall der Monstren und die Überwindung des Gebirges und Ankunft im paradiesischen Tal der Zauberin setzt Salieri in seiner Ouvertüre „Sinfonia in pantomima“ gekonnt in Musik um. Er zeigt hier, dass Musik nicht nur dazu da ist, Arien zu begleiten, sondern dass sie ganz für sich stehen kann. Das ist eine musikhistorische Neuerung. Die Vorgeschichte der Opernhandlung wird tonmalerisch gestaltet ganz im Gegensatz zu der damals weitgehend üblichen Beliebigkeit vieler Ouvertüren. Zum ersten Mal setzt Salieri hier auch Posaunen außerhalb der Kirchenmusik ein.
Auch seine Opera buffa „La scuola de‘ gelosi“ (1778) enthält einige Neuerungen. Diese komische Oper um drei Paare aus unterschiedlichen Schichten mit Verwicklungen und Eifersüchteleien war ein Riesenerfolg und wurde zu einem jahrzentenlangen Dauerbrenner in ganz Europa. Mozarts „Cosi fan tutte“ ist quasi eine Fortsetzung dieser Oper. Auch im „Figaro“ gibt es viele Details, die Mozart ähnlich wie Salieri macht. Als spektakulär wurde das „Quintett an den Spieltischen“ empfunden, in dem zeitweise alle gleichzeitig singen und ein sprachliches Wirrwarr entsteht, während das Orchester ein durchgehendes Motiv spielt. Goethe fand, dass dieses Quintett ganz neu sei und alles in den Schatten stelle.
Dramatisch wurde es mit Salieris Oper „Les Danaïdes“ (1784). Dieser antike Mythos mit seinen 99 Toten gehört zu den düstersten Stoffen. Zwei verfeindete Brüder mit jeweils 50 Töchtern und 50 Söhnen planen eine Massenhochzeit ihrer Kinder zur Versöhnung. Die Töchter des Danaus sollten aber ihre Männer in der Hochzeitsnacht töten. Die älteste Tochter Hypermnestre verschont ihren Gatten. Dieser kann fliehen und kehrt mit seinen Kriegern zurück. Die Danaïden werden gefesselt und von Dämonen und Schlangen gequält und von Furien gepeinigt. Danaus wird an einen Felsen geschmiedet, seine blutigen Eingeweide werden von einem Geier zerfressen. Diese martialische Schlussszene bezeichneten zeitgenössische Besucher voller Begeisterung als „Weltwunder“ und „Höllenaufführung“. Es muss ein riesiges Spektakel gewesen sein. Mauern stürzten ein, Feuerregen fiel vom Himmel, die Erde bebte und die Schreie der Gemarterten gingen durch Mark und Bein. Mit diesem grandiosen Musikbeispiel verabschiedeten sich die beiden Salieri-Kenner vom begeisterten Publikum, das nicht mit Applaus für diesen unterhaltsamen und interessanten Musiktage-Talk sparte.
Info: Erstes Konzert der Musiktheater am Mittwoch, 24. September, 19 Uhr, im Rathaus: Matthias Lucht und das Ensemble Operino präsentieren „Musikschätze aus der Wiener Hofkapelle“.
Restkarten an der Abendkasse.
Text: Carmen Diemer-Stachel
Foto: Stadt Walldorf