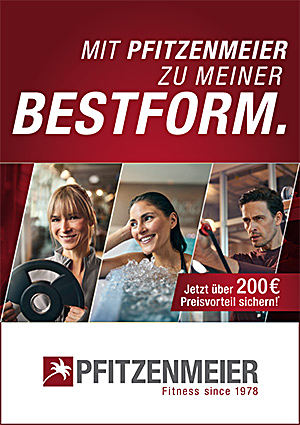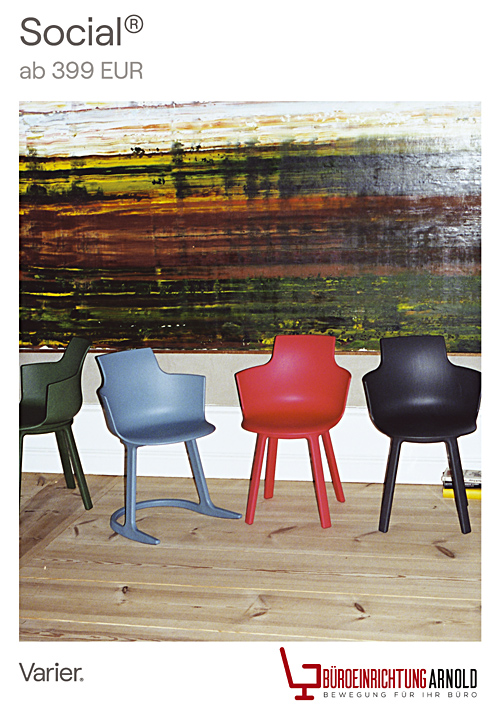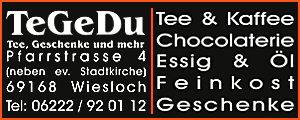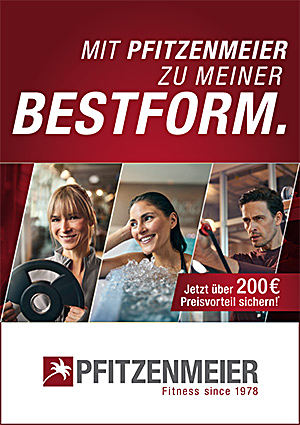„Jeder hat es mitbekommen“
Schon seit einigen Jahren laden am 9. November die evangelische Kirchengemeinde und die Vereinigung Walldorfer Heimatfreunde gemeinsam zum traditionellen Gedenken an die Reichspogromnacht ein, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stattfand.
„Es ist ganz wichtig, dass wir das machen“, betonte Pfarrer Uwe Boch in seiner Begrüßung der Teilnehmenden auf dem Marktplatz deutlich. Die Führung in der Walldorfer Altstadt zu historisch bedeutsamen Orten, die während des Pogroms eine große Rolle spielten, übernahm Andy Herrmann.
Im Alten Rathaus in der Nähe des Marktplatzes seien schon früh Aktivitäten gegen jüdisches Leben in Walldorf geplant worden. Im September 1935 habe der Gemeinderat beispielsweise beschlossen, den Zuzug von Juden nach Walldorf zu verbieten – ohne rechtliche Grundlage, wie Herrmann betonte. Diese sei nachträglich durch Unterstützung von NSDAP-Kreisleiter Wilhelm Seiler eingeholt worden. Schon in diesem Zuge sei unverblümt von der „Ausrottung der Juden in Deutschland“ gesprochen worden – „wirtschaftlich genau wie in jeder anderen Beziehung“.
Auch in Walldorf habe es zunehmend Repressalien gegen Juden gegeben. An öffentlichen Plätzen – etwa zwischen dem Gasthaus zum Lamm und der damaligen Sparkasse – sei die antisemitische Wochenzeitung „Der Stürmer“ ausgehängt worden. Am Morgen des 10. November fand dann der organisierte Angriff in Walldorf statt, so Herrmann, der während des Rundgangs vom Marktplatz zum ehemaligen Weißen Rössl führte, wo früher das Haus des Hopfenhändlers Moses Klein stand. Fotos vom Tag des Pogroms zeigten das Gebäude mit eingeschlagenen Fenstern sowie einer großen Menschenmenge, die sich davor versammelt hatte. An den Aktionen beteiligten sich laut Herrmann auch Nazis aus Wiesloch und Bruchsal – meist Angehörige der SA und SS. Einige hätten jedoch keine Uniform getragen, um nach außen den Eindruck zu erwecken, es handle sich um einen spontanen Aufstand der Bevölkerung. Klar sei in jedem Fall: „Es war am helllichten Tag – jeder hat es mitbekommen.“
Herrmann machte auch auf Einzelschicksale aufmerksam, etwa auf Nanny Weil, deren Schuhgeschäft in der Hauptstraße 10 Ziel des Angriffs war. Das Geschäft habe sie kurze Zeit später schließen müssen. Die 56-jährige Jüdin Anna Klein, die im selben Gebäude wohnte, habe sich unter dem Eindruck des Pogroms am 11. November das Leben genommen und sei damit „das erste Walldorfer Opfer des antisemitischen Terrors der Nazis“.
Die Täter machten auch vor der Synagoge am Schlossplatz nicht Halt. Die Inneneinrichtung sei demoliert, viele Gegenstände – darunter die Thorarollen – zerstört worden. Wegen der dichten Bebauung sei das Gebäude auf Intervention des damaligen Bürgermeisters Leibfried nicht in Brand gesetzt worden, um die Nachbargebäude zu schützen. Erst vor Kurzem sei man auf Fotos gestoßen, die die Zerstörung der Synagoge am 10. November dokumentieren.
Nach dem Rundgang folgten die Teilnehmenden der Einladung von Pfarrer Uwe Boch in die evangelische Stadtkirche, wo ein kurzer Gedenkgottesdienst den Abend in würdiger Atmosphäre ausklingen ließ.
Text und Fotos: Stadt Walldorf