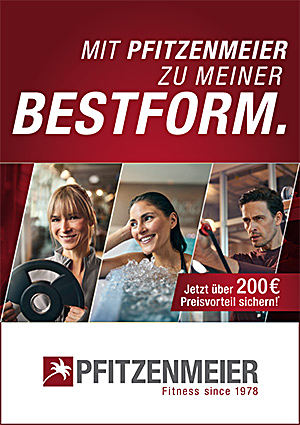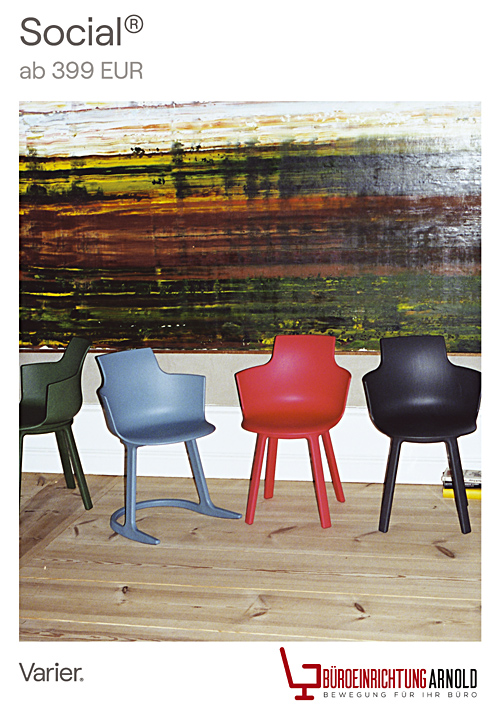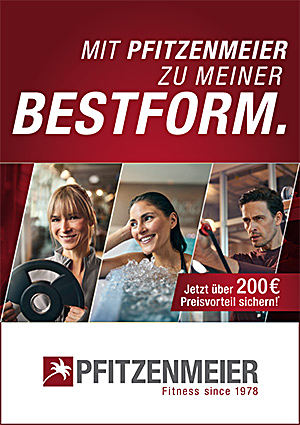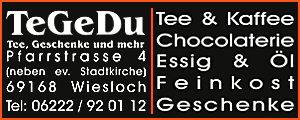Sie ernteten für den ersten Walldorfer Science Slam rauschenden Applaus in der bestens besuchten Astoria-Halle: (v.li.) Hannah Meyer, Arne Nister, Moderator Rainer Holl, Anastasia August, Daniel Trippe und Michael Watson.
Man müsste ein Eisbär sein – Warum, erklärt die Siegerin des ersten Walldorfer Science Slams
Die „Modellierung des Wärmetransports in porösen Strukturen unter anderem unter dem Einfluss von Strömungen“ zählt zu den Forschungsaktivitäten von Dr. Anastasia August am Institut für Angewandte Materialien, Mikrostruktur-Modellierung und Simulation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Klingt schwer verständlich? Nicht beim ersten Walldorfer Science Slam, bei dem die Wissenschaftlerin auf der Bühne der Astoria-Halle mit viel Humor und auch für den Laien absolut einleuchtend erklärt, was die Haut der Eisbären mit einem energieeffizienten Gebäude zu tun haben könnte. Dafür geht sie am Ende mit einem goldenen Paar Box-Handschuhe unter viel Applaus des begeisterten Publikums als Siegerin des ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Wettbewerbs nach Hause. Die mehr als 300 Zuschauerinnen und Zuschauer spenden aber auch den vier weiteren Teilnehmern reichlich Beifall, die ebenfalls spannende Themen aus der aktuellen Wissenschaft gut verständlich präsentiert haben. „Danke, Walldorf“, freut sich Moderator Rainer Holl über den prächtigen Zuspruch.
Die Haut des Eisbären, so Anastasia August, sei „eine Spitzenleistung der Evolution“. Denn sie ist, gut unter dem weißen Fell verborgen, schwarz. Und Schwarz „reflektiert nichts, sondern absorbiert alles Licht, auch Energie“. Wie jeder weiß: „Schwarze Gegenstände werden wärmer, wenn sie in der Sonne stehen.“ Allerdings je nach Material nur bis zu einem gewissen Grad, dann setzen sie der solaren ihre thermische Strahlung entgegen. Die Natur hat dem Eisbären einen besonderen Trick spendiert: „Die weißen Fellhaare sind so gebaut, dass sie für die solare Strahlung durchlässig sind“, so die Wissenschaftlerin. Nicht jedoch für die zurückstrahlende thermische, die deshalb wieder an die schwarze Haut geleitet wird, hin und her. So hat es der Eisbar auch am kalten Nordpol kuschelig warm. Die Wissenschaft bildet das nun mit textilem Gewebe, Kunststoff und einer Schicht aus Polyesterfäden nach: „Die schwarze Struktur wird sehr heiß, bis zu 150 Grad im Sommer, darauf können Sie Eier braten“, schildert Anastasia August den Prozess anschaulich. Lässt man durch ihr Konstrukt nun Luft strömen, wird die Wärme mitgenommen und kann in einen Wärmespeicher eingespeist und genutzt werden. Noch sind die Verluste hoch, die Speicher nicht perfekt, gesteht die Wissenschaftlerin. Aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden. Und ihr Vortrag begeistert das Publikum restlos und kürt sie zur Siegerin.
Die Konkurrenz beim Science Slam, einem unterhaltsamen Format zur Wissenschaftsvermittlung, das sonst in größeren Städten wie Heidelberg oder Mannheim über die Bühne geht („da reiht sich Walldorf gut ein“, so Bürgermeister Matthias Renschler mit einem Schmunzeln in seiner Begrüßung), ist groß. „Das ist ofenfrische Forschung, die uns präsentiert wird“, macht Moderator Holl neugierig und findet mit dem zwölfjährigen Philipp einen Freiwilligen im Publikum, der gemeinsam mit seinem Onkel Nelson mit der Glocke auf das Ende des jeweiligen Zeitlimits von zehn Minuten aufmerksam macht. Sonst gibt es nur die Regeln, dass „eigene Forschung“ vorgestellt werden muss – und dabei „alles erlaubt“ ist, was der Wissensvermittlung dient. Dazu zählen an diesem Abend Präsentationen auf der großen Leinwand mit bewegten Bildern, Fotos und Grafiken, aber beispielsweise auch ein großes Glas Bier und eine noch größere Kiste mit unter besonderen Bedingungen gewachsener Kresse.
Die Kresse hat Daniel Trippe aus Karlsruhe mitgebracht, der sich mit „Vertical Farming“ beschäftigt. Nach seinen Worten hat sie „noch nie die Sonne gesehen“ und ihre Wurzeln haben noch nie in Erde gesteckt. „Sie ist in einem Indoor-System aufgewachsen“, einer großen Halle, die bis unters Dach vollgepackt sei. In Singapur, China oder den USA funktioniere das bereits vollautomatisch, Deutschland müsse schauen, „dass wir nicht den Anschluss verlieren“. Trippe schildert die Vorteile: Die Pflanze werde in ein Substrat gesetzt, die Nährstoffe erhalte sie über das Gießwasser, das LED-Licht strahle auf den bevorzugten Wellenlängen und die Regelung von Luftfeuchtigkeit und –temperatur sorge für „den perfekten Frühlingstag“ – rund um die Uhr. Das Kreislaufsystem spare bis zu 95 Prozent an Trinkwasser gegenüber einer herkömmlichen Bewirtschaftung. „Ich kann auf einer geringen Fläche ein Vielfaches an Ertrag produzieren“, sagt Trippe, verschweigt aber auch nicht die Kehrseite: den immensen Einsatz von Energie. Deshalb müsse man genau hinschauen, wo die Methode „sinnvoll und nachhaltig“ sei. „Es gibt heute schon Anwendungsmöglichkeiten – und erst recht morgen“, gibt sich Trippe überzeugt.
Der Wieslocher Michael Watson betätigt sich auf dem Feld der Biodiversität und arbeitet als Gründer einer Firma an unterschiedlichen Naturschutzmaßnahmen. „Wie retten wir die Welt?“, widmet er sich dem „gigantischen Problem der Biodiversitätskrise“. Watson sagt: „Wir wissen, was wir tun müssen.“ Das eigentliche Problem sei aber, dass die Menschen es nicht schafften, ihr Verhalten zu ändern. Am Insektensterben und der emotionalen Reaktion darauf zeigt er, dass „die Sensibilisierung auf einem guten Weg“ sei, das aber längst nicht ausreiche. Um das Vertrauen bei den Menschen zu schaffen, die Herausforderung meistern zu können, brauche es eine „interaktive, hoffnungsvolle Naturschutz-Kommunikation“, so Watson. Mit der könne man zeigen, „dass Naturschutz Spaß macht und mit den eigenen Händen durchgeführt werden kann“.
Arne Nister aus Darmstadt entführt das Publikum in die Welt der Chemie. Die Gemeinsamkeit von Medikamenten, Kunst- und Farbstoffen? „Nahezu alle Produkte der chemischen Industrie sind Kohlenwasserstoffe“, sagt Nister, zentraler Bestandteil sei Erdöl. Er erklärt die komplexen Prozesse in einer Raffinerie und stellt die Frage, ob man alternativ nicht CO2, „den Hauptverursacher der Klimakrise“, chemisch nutzbar machen könne. Das sei ein „träges, langsames Molekül“, zieht er den Vergleich zum „Wandern mit Teenagern“, einen Gipfel zu erklimmen, sei mit ihnen schwierig bis unmöglich. Dank des Einsatzes von Katalysatoren könne man CO2 und Wasserstoff aber tatsächlich in die gewünschte Reaktion bringen. Der Nachteil: „Wir brauchen Unmengen an Energie und Wasserstoff.“ Die Forschung in diese Richtung sei „total wichtig“, so Nister, die Nutzung bei den aktuellen Stromkosten aber noch nicht darstellbar.
Naturgewalten anderer Art haben die promovierte Umweltphysikerin Hannah Meyer beschäftigt, die über „Die geheimen Reisen der Wüstensande“ spricht. „Sandy McDust“ nennt sie den Mineralstaub, winzige Partikel, die beispielsweise in der Sahara durch starke Winde aufgewirbelt werden, oft in den USA, unter bestimmten Bedingungen aber auch gelegentlich hierzulande ankommen. Die Luftqualität, die Leistung von Photovoltaikanlagen, aber auch Wolken und der Niederschlag werden nach ihren Worten davon beeinflusst. Der Staub könne Gletscher schneller zum Schmelzen bringen und doch sei sich die Wissenschaft noch nicht schlüssig (wie übrigens auch das Publikum), ob er eher wärmt oder kühlt. Hannah Meyer war mit ihrer Forschungsgruppe in Jordanien und Island, bei über 40 Grad in der Wüste und knietief im geschmolzenen Gletscherwasser, hat den Staub gemessen, beprobt und „einen Haufen Daten“ gesammelt. Noch ohne endgültiges Ergebnis: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die klimatische Unsicherheit zu verringern“, sagt sie.
Am Ende des Abends entscheidet der Applaus des Publikums über die Siegerin – Gewinner sind aber letztlich alle, die Teilnehmer, die ihre Themen mit viel Leidenschaft präsentiert haben, und die Zuschauer, die spannende Einblicke gewonnen haben.
Bürgermeister Matthias Renschler hat sich schon zu Beginn über die „vielen Neugierigen und Wissbegierigen“ gefreut, die den Weg in die Astoria-Halle gefunden haben. Für die Bewirtung sorgen Schüler der Abitur-Klasse des Gymnasiums. Ihnen gilt der Dank des Bürgermeisters ebenso wie dem Team von „Science & Stories“, vertreten durch Sebastian Ranke und Moderator Rainer Holl, sowie dem städtischen Fachdienst Umwelt unter der Leitung von Alena Müller, die den Abend gemeinsam organisiert haben. Einhelliger Tenor: Es soll nicht der letzte Science Slam in Walldorf gewesen sein.
Text und Fotos: Stadt Walldorf